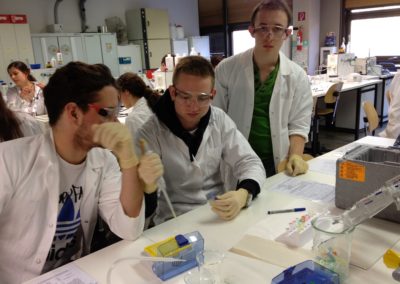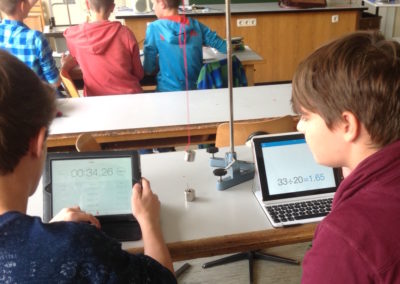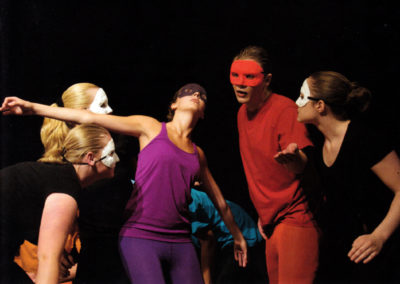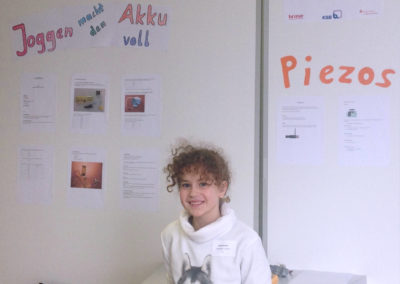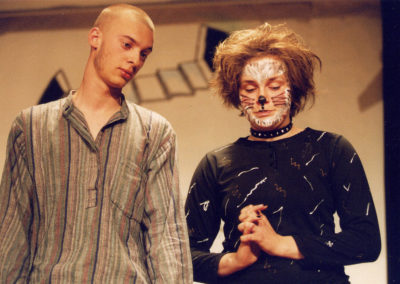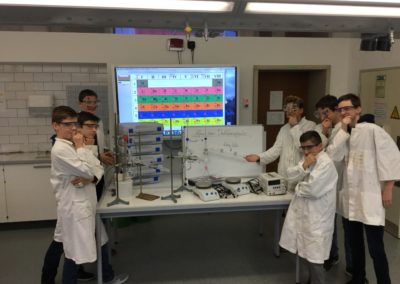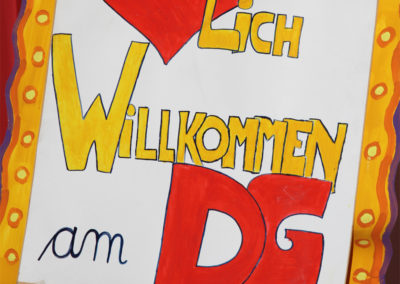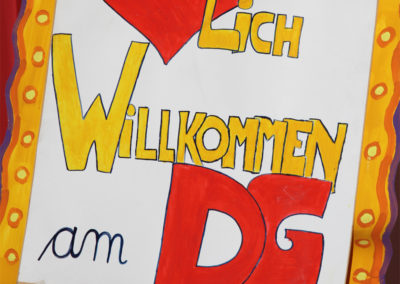Fragt man Schüler der fünften Klasse, was ‘Entwicklungsländer’ sind, so bekommt man häufig die Antwort: „Na, wir zum Beispiel – Deutschland, die USA, Frankreich, usw.“ Verblüfft? Die Fünftklässler geben jedoch eine für sie plausible Antwort: „Deutschland, die USA und Frankreich sind entwickelt, also sind dies ‘Entwicklungsländer’.“ In der Q11/12 erhält man zwar die richtige Definition und die OberstufenschülerInnen nennen auch die entsprechenden Länder, wie Niger, Malawi oder Uganda, aber häufig wird das Thema Entwicklungshilfe eher theoretisch behandelt. Man spricht über diverse Entwicklungstheorien, verschiedene Entwicklungsdefizite, Indikatoren und Wirtschaftsfaktoren, aber wer von uns war tatsächlich schon einmal in Afrika oder gar in einem echten Entwicklungsland?
Daher sind wir immer froh, wenn Frau Janina Möck am DG einen Vortrag über das von ihr gegründete Entwicklungshilfeprojekt „We care for them“ spricht. Hier wird auch für jeden klar, was „Hilfe zur Selbsthilfe“ in der Praxis bedeutet.

Als Frau Möck nämlich nach ihrem Abitur im Jahr 2013 ein freiwilliges soziales Jahr in Afrika absolvierte und hierbei für eine große Entwicklungshilfe-Vereinigung arbeitete, musste sie hautnah miterleben, dass viele der dort initiierten Projekte überhaupt nicht zielführend waren, weil man die Bevölkerung vor Ort in keinster Weise mit einbezogen hat. Daher gründete Frau Möck kurzerhand im Jahr 2014 ihr eigenes kleines Entwicklungshilfeprojekt mit dem Namen „We care for them“. Hier kümmert sie sich mit ihrem Team aus Einheimischen momentan um 18 Waisenkinder und deren schulische Ausbildung. Sie hat mittlerweile mit Spendengeldern zwei Wohnhäuser mit eigenem Wasseranschluss und einer regenerativer Stromversorgung errichten lassen und eine kleine Selbstversorger-Landwirtschaft aufgebaut.



Aufgrund dieses außergewöhnlichen und erfolgreichen Engagements wurde „We care for them“ nun sogar für den „Deutschen Engagement Preis 2022“ nominiert.

Was Frau Möcks Vortrag jedoch so überzeugend macht, ist die Tatsache, dass sie keine Schönfärberei betreibt, sondern auch die „hausgemachten“ Probleme Ugandas offen anspricht, z.B. das extreme Bevölkerungswachstum. So liegt der Altersdurchschnitt in Uganda bei nur 15 Jahren (im Vergleich dazu: 44 Jahre in Deutschland), das heißt die SchülerInnen der Q11/12 sind bereits älter als die meisten Bewohner von Uganda. Es gibt Familien mit bis zu 16 Kindern. Polygamie ist keine Seltenheit und Blutsverwandtschaft ist für uns oft nur eine Floskel, in Uganda hat diese jedoch dramatische Auswirkungen. Wenn zum Beispiel ein Mann seine Frau und die gemeinsamen Kinder verlässt, was häufiger vorkommt, und die Frau einen neuen Partner findet, so wird dieser sich niemals um die Kinder seines „Vorgängers“ kümmern, sondern nur um seine eigenen, blutsverwandten Kinder. Lediglich bei Beerdigungen muss jeder Blutsverwandte, und somit alle Kinder eines Mannes, erscheinen. Dabei erfahren die Kinder oft zum ersten Mal, dass sie noch zahlreiche weitere Geschwister haben. Vorher ist dies unmöglich festzustellen, denn es gilt als „völlig respektlos“, einen Mann zu fragen, wie viele Kinder er denn habe. Glücklicherweise ist, so Frau Möck, die neue Generation von ugandischen Männern nicht mehr so in dieser verantwortungslosen Tradition verhaftet und Frau Möcks Projekt leistet diesbezüglich einen wichtigen Beitrag.
Wenn Frau Möck von ihrem „Waisenhaus“ spricht, so erläutert sie, dass dort eigentlich nur ein echtes Waisenkind wohnt, bei allen anderen Kindern gibt es sicherlich noch irgendwo eine Familie, aber man weiß aufgrund der oben geschilderten Situation nicht, wo sie aufzufinden wäre. Daher ist es um so erfreulicher, wenn man die Erfolgsgeschichten von Kindern hört, die aufgrund von „We care for them“ aus miserablen Verhältnissen befreit wurden und nun eine echte Zukunftsperspektive haben. Diese Geschichten kann man auch unter folgendem Link bei „Unsere Patenkinder – Die Stories“ nachlesen.
https://wecareforthem.de/

Außerdem spricht Frau Möck ehrlich über die Mentalität der Bewohner von Uganda, dem 17-ärmsten Land der Welt. Man lässt sich dort Zeit, ist entspannt, weniger reflektiert und nicht so sehr auf Leistung getrimmt wie bei uns. Dies wird beispielsweise im Bereich der Landwirtschaft deutlich. Uganda liegt am Äquator und es gibt zwei Regenzeiten. Vor der Regenzeit muss man aussäen, damit man nach der Regenzeit ernten kann. „Entspannte Ugander“ säen oftmals zu spät aus, wollen dann aber ihren Fehler nicht eingestehen und, wenn die Ernte schließlich zu gering ausfällt, sagen sie einfach: „Es hat zu wenig geregnet.“
Erstaunt erfahren wir, dass es bei uns eine sogenannte „Schuldkultur“, in Uganda jedoch eine vorherrschende „Schamkultur“ gibt, wobei Frau Möck den Unterschied sehr anschaulich erklärt. Wenn wir zum Beispiel das Handy eines Freundes versehentlich kaputt machen, entschuldigen wir uns normalerweise, versuchen es reparieren zu lassen oder ersetzen es. Ein Ugander würde niemals einen Fehler zugeben oder sagen, dass er etwas falsch gemacht hat – eher würde er das Handy wegwerfen oder vergraben und sagen, dass er dieses Handy niemals gesehen habe.
Aufgrund dieser kulturellen Unterschiede hat Frau Möck ihre elf MitarbeiterInnen vor Ort besonders sorgfältig ausgewählt und kann sich nun aber voll und ganz auf sie verlassen. Deshalb läuft ihr Entwicklungshilfeprojekt selbst dann gut weiter, wenn sie und ihr Mann in Deutschland sind. Dies ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, denn andere Entwicklungshilfeprojekte brechen häufig in sich zusammen, wenn die Leiter aus Europa wieder in ihre Heimat zurückfliegen und das, was an nützlichen oder wertvollen Gegenständen vor Ort vorhanden ist, wird anschließend oftmals von den Einheimischen geklaut.

Die Waisenkinder von Frau Möck können aufgrund der Spendengelder für „We care for them“ zudem gute Schulen besuchen und müssen nicht auf staatliche „Alibi-Schulen“ gehen, die meist noch nicht einmal in einem stabilen Haus untergebracht sind, in der die Lehrer selbst kaum lesen oder schreiben können und die nur gegründet wurden, damit der Staat sagen kann, er würde sich doch um die Ausbildung der Kinder kümmern. Auch Nachhaltigkeit zeichnet Frau Möcks Projekt aus. So versorgt der Sonnenkollektor auf dem Waisenhaus nicht nur dieses Wohnhaus mit Strom, sondern zudem noch das Dorf. Die neueste Aktion von „We care for them“ bestand darin, auf einem ein Hektar großen Feld 1.000 Bäume anzupflanzen, denn diese sind für den Boden und somit für die Landwirtschaft sehr vorteilhaft, sie spenden Schatten und bieten einen perfekten Windschutz.

Bei „We care for them“ kann man nicht nur eine Patenschaft für ein Kind übernehmen, sondern auch, zum Beispiel nach dem Abitur, ein Praktikum absolvieren. Dabei hat man sogar die Gelegenheit, eine Safari, z.B. zum Victoriasee, zu unternehmen. Oder vielleicht besucht man die Nomaden im Norden von Uganda, das etwa drei Viertel so groß wie Deutschland ist, denn dort gibt es einen mit den Massai verwandten Nomadenstamm. Diesen wird man auf den ersten Blick erkennen, denn sie leben wie früher, kleiden sich nicht, haben traditionelle Narbentattoos und zur besseren Identifikation ziehen sie sich die vorderen Zähne.
Wir danken Frau Möck für ihren interessanten Vortrag, bei dem man über Land und Leute in Uganda Dinge erfahren hat, die man in keinem regulären Schulbuch für Geographie sonst findet.

We care for them: IBAN: DE 7276 39 1000 0007 7528 49; BIC: GENODEF1FOH; Volksbank Forchheim eG
G. Merz