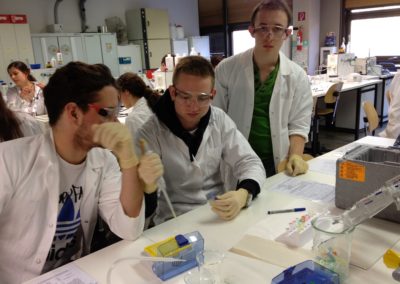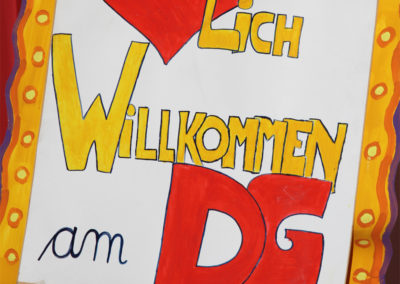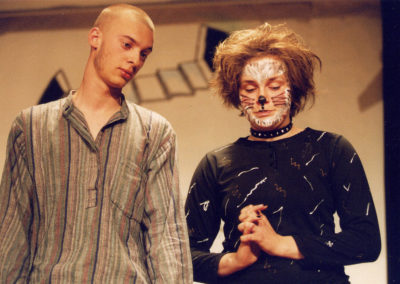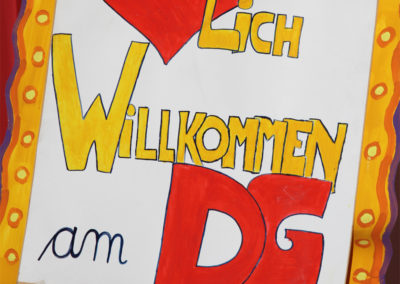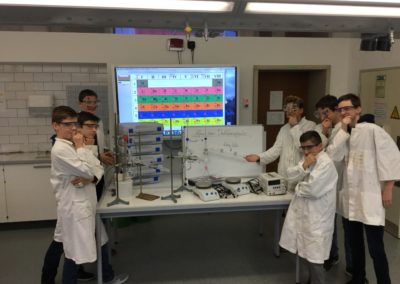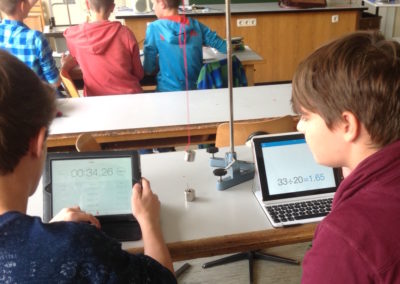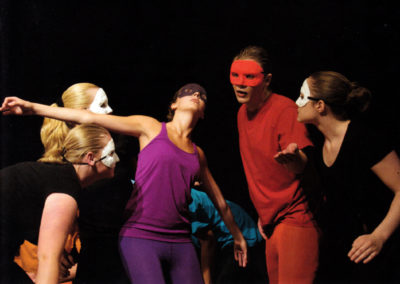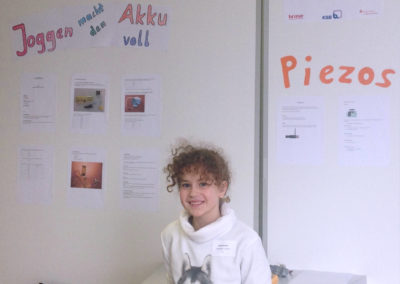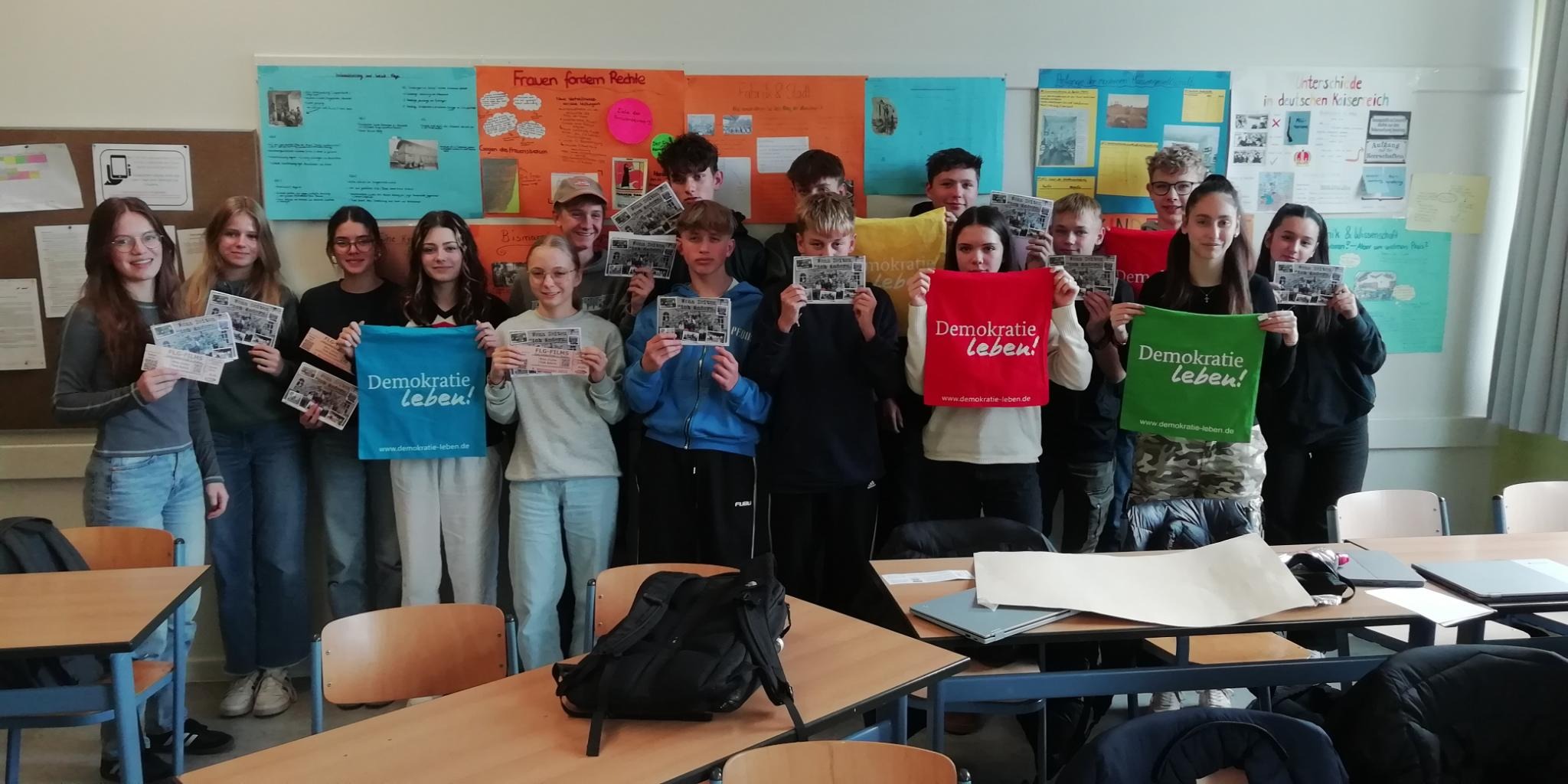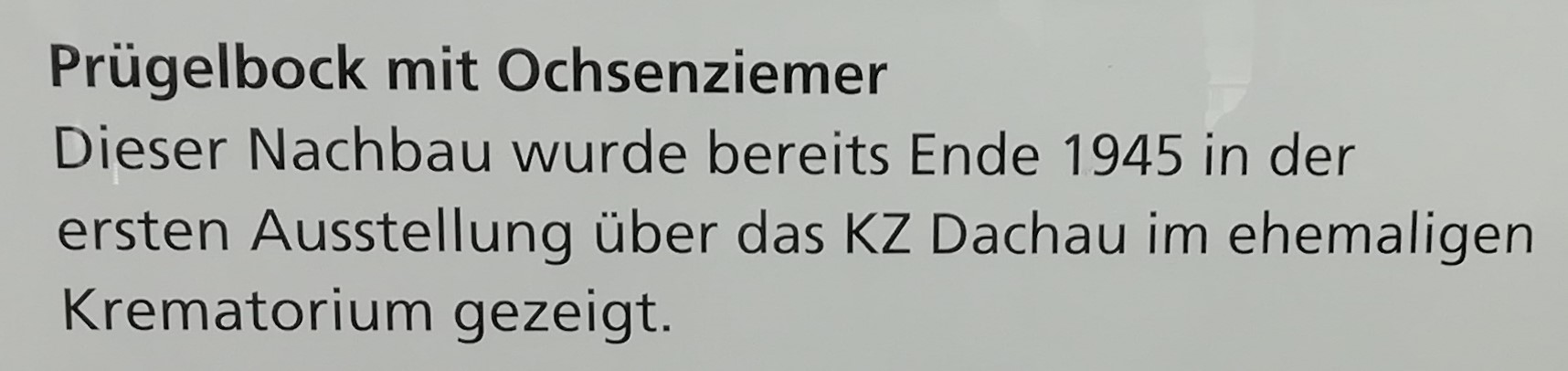Weimar … und: Das Konzentrationslager Buchenwald (Leon Sander)
Die Durchsage „wir sind bald da!“ lässt uns Schüler im Bus munter werden. Galgenhumor – ein Ausdruck der Überforderung. Eine umso drückendere Stimmung, je näher wir diesem grausamen Ort kommen. Wir sind da!
Die Lehrkräfte starten die Führung, sie lassen uns durch ihre Exkurse in die Vergangenheit abtauchen, in die Jahre 1933ff. Alle hörten gespannt zu; der Exkurs in die längst vergangene Zeit endet jedoch zeitig und aus dem vorherigen Galgenhumor wird Interesse: das Interesse, sich alleine auf den Weg zu machen und zu erfahren, was hier passiert ist. In kleinen Gruppen untersuchten wir das Gelände auf alte Überreste des längst demontierten Konzentrationslagers ab. Denn wir stellten uns viele Fragen. Am Tor steht der bekannte Satz „Jedem das seine“. Von außen ist dies spiegelverkehrt geschrieben, sodass es die Insassen lesen können. Das Motto bedeutet eigentlich z.B., dass ein Mensch den Lohn bekommt, den er verdient – aber für diese vielen unschuldigen Menschen bedeutet er nichts Gutes. Das größte Interesse auf dem weitläufigen Gelände weckte das Krematorium. Schon beim Betreten dieses Lagers des Grauens fiel auf, dass dieses Gebäude gut erhalten war. Im alten Gebäude konnten wir uns bildlich vorstellen, was hier geschah: Ein ungutes Gefühl erfasste die Gruppen, eine bedrückende Stille fuhr durch alle Gruppen. Doch die Neugier siegt erneut. Wir erkunden das Gelände weiter.
Das 400.000 Quadratmeter große Gelände scheint sehr übersichtlich; es hat eine klare Struktur. Leicht überwachbar ist es von allen Seiten, doch es erscheint unvorstellbar, dass hier 277.800 unschuldige Menschen festgehalten und gefoltert wurden, nur weil sie eine andere Religion, Herkunft oder Meinung hatten.
Ein Lager – im Lager?
Das kleine Lager, eigentlich ein Stall, gerade mal so groß, dass 50 Pferde hineinpassen, wird zur NS-Zeit umgebaut zu einer Hölle auf Erden. Dort mussten durchschnittlich 2000 Menschen leben. Im Jahre 2023 zeigt sich uns eine Gedenkstätte, grünes Gras, hohe Bäume und Vogelgezwitscher – überall Zeichen für Leben! Doch in den 1940er Jahren liegt ein Gestank des Todes in der Luft. Auch hat die SS die Bäume gefällt, um den Insassen das vielleicht letzte Zeichen der Hoffnung, die immer wieder aufbrechende Natur, zu nehmen.
Das Interesse wandelt sich zu einigen Erkenntnissen: Was unterscheidet den Menschen von Tieren? Der Mensch besitzt kognitive Fähigkeiten, Kultur, Zivilisation und ein Bewusstsein. Wenn wir Menschen dies nicht mehr haben, sind wir dann Tiere? Die SS, die zur Zeit Hitlers als Unterdrückungswerkzeug diente, leitete diese Lager mit Brutalität und Zynismus. Die Gefangenen wurden zu Nummern, man nahm ihnen die Menschlichkeit, die Namen und die Identität und versuchte, die oben genannten Eigenschaften auszutreiben. Durch all diese Grausamkeit und Brutalität des Lagersystems zeigt die SS, dass sie keine Menschlichkeit kennt – sind das noch Menschen?
Nach der Abfahrt aus der Gedenkstätte hielten wir noch kurz an einem Zeugnis monumentaler DDR-Architektur, das bereits kurz nach dem Bau wie auch heute noch umstritten ist, u.a. wegen der Auswahl von Inhalten sowie eben der monumental gehaltenen Bauweise im „Stil totalitärer Herrschaftsarchitektur“, wie es auf der Homepage des Mahnmals heißt. „Doch indem den Toten mit dem Rückgriff auf eine klassische Formensprache ein monumentaler Gedächtnisort errichtet wurde, ist das Mahnmal auch als ein Versuch zu sehen, sowohl auf die Größe des Verbrechens als auch auf das Vergessen der Zeit zu reagieren.“

In ägyptischem Stil gestaltet und weitgeschwungenem Bogen aufgestellt: die Feuerschalen.

Auf den insgesamt sieben Opferstelen sind die Nationen vermerkt, deren Angehörige in Buchenwald leiden mussten und zu oft zu Tode kamen. Sieben Stelen – für sieben Jahre Terror und Gewalt.

Der berühmte Glockenturm – eines der unfreiwilligen Wahrzeichen Weimars, bereits aus der Ferne zu sehen.
Auf der Homepage des Mahnmals findet man einen Übersichtsplan, der die überwältigende Größe der Anlage verdeutlicht; interessant auch die Hinweise auf die Nachnutzung bzw. den Verfall des Komplexes, dessen sich die Verantwortlichen erst spät bewusst wurden (vgl. https://www.buchenwald.de/de/geschichte/historischer-ort/gedenkstaette/mahnmal).
Kontrastprogramm: Kunst, Kultur und Kunsthandwerk auf höchstem Niveau – ein Tag in Weimar (Annika Raab und Madlen Hauptmann)
Unsere „Fußbusfahrt“ begann unter musikalischer Begleitung durch Stan. Doch das war längst noch nicht alles. Nachdem wir auf dem Marktplatz angekommen sind, ging es für „Team Helmi“ direkt weiter zum Nationaltheater, vor allem zu den berühmten Statuen von Schiller und Goethe.

Darf bei keiner Weimartour fehlen: das berühmte Theater mit den beiden berühmten Dichtern …
Bei unserem Rundgang haben wir gekonnt jede Abkürzung gemieden, wodurch jedoch eine umso informativere Stunde über Goethe, Schiller, Wieland, Herder und Kotzebue entstand,
Schöne Ecken in einer schönen kleinen Stadt:


Wittumspalais und Schloss
welche uns zum Bauhaus Museum führte.
Dort wurde leider einiges an Vorwissen vorausgesetzt, weshalb der Tourguide womöglich mehr enttäuscht von uns war als wir von seiner Führung. Doch immerhin konnte Frau Helmstetter mit ihren eigenen Einwürfen besser unser Interesse für das Thema wecken.

Bild Blick ins Bauhausmuseum
Danach konnte es nur bergauf gehen und so war es auch. Die nette Dame im Goethe-Museum konnte uns mit ihrer Führung begeistern, bevor wir uns wieder auf den Rückweg nach Bamberg machten.
Die Welt und die Liebe… und die Liebe zur Welt, ansprechend aufbereitet im Museum:


Immer wieder faszinierend: das virtuelle Lexikon zu Goethes Werken

Immer wieder beeindruckend: der Adler im „römischen Zimmer“

Am Ende war Goethe 83 Jahre alt: ein Blick in sein Sterbezimmer.

Wir Lehrkräfte schließen uns den geschilderten – zumeist positiven – Eindrücken gerne an und sind der Meinung, dass die zweitägige Fahrt mit den Blicken auf die glanzvollen wie die düsteren Seiten unserer Geschichte und Kultur gewinnbringend war. Sehr erfreulich war auch die diesmal konstruktive und harmonische Atmosphäre in den Gruppen, die die Fahrt auch in Sachen Teambuilding und Geselligkeit zu einem Erfolg werden ließ.
B. Helmstetter, R. Plischke, B. Reidelshöfer, R. Rempe