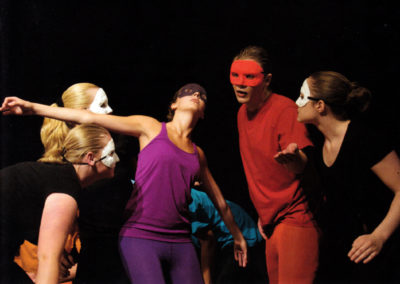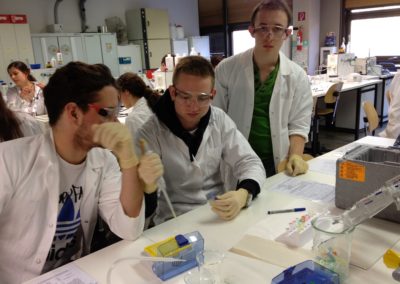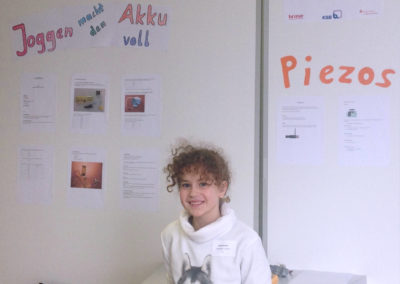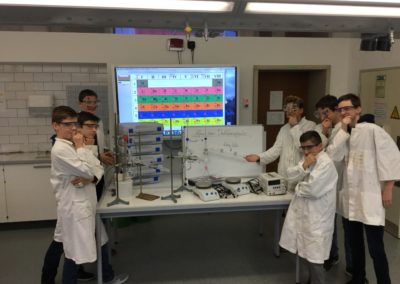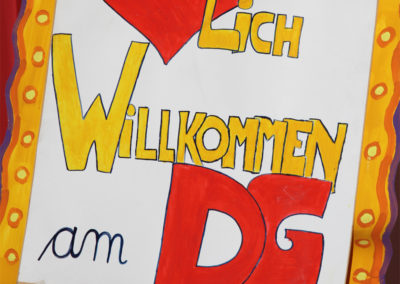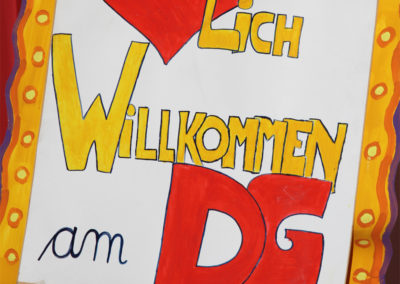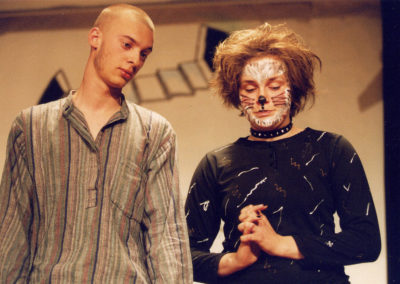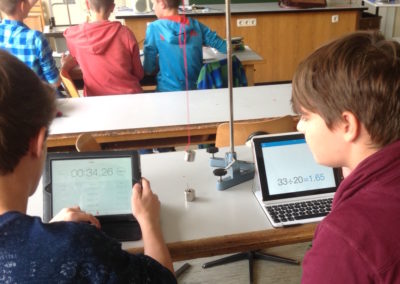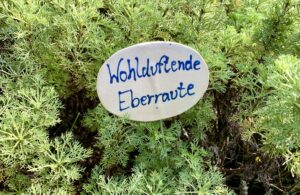Ein Welterbetitel ist mehr als nur ein prestigeträchtiges Tourismussiegel. Er ist auch ein weicher Standortfaktor für die Wirtschaft. Selbst Brose bewirbt seinen Sitz in Bamberg mit dem Welterbetitel unserer Stadt. So lag es nahe, dass das P-Seminar „Bamberg – Gärtnerstadt – Welterbestadt: Erstellung von Informationsfilmen zur Gärtnerstadt Bamberg“ auch einmal einen Blick hinter die Kulissen des Bamberger Welterbezentrums wirft, um festzustellen, welche verschiedenen Berufe und Tätigkeitsfelder es dort gibt, denn die Ausstellung im Besucherzentrum hatten wir uns bereits angesehen.
Eigentlich sollten wir eine „Privataudienz“ bei Frau Patricia Alberth, der Leiterin des Zentrums Welterbe Bamberg, haben, was sicherlich sehr interessant gewesen wäre, da sie als eine von rund 100 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur im Rahmen der Initiative „Botschafter für Bamberg“ für unseren Wirtschaftsraum wirbt. Oberbürgermeister Andreas Starke sagte bei ihrer Ernennung: „Bangkok. Paris. Bamberg. Die beruflichen Stationen von Frau Alberth sprechen für sich. Sie vertritt unser Welterbe auf nationaler und internationaler Ebene mit großem Erfolg.“
Da aber Frau Alberth kurzfristig verhindert war, empfing uns eine im Welterbezentrum arbeitende Volontärin, von der wir aber aufschlussreiche Informationen über ein Studium und den Berufseinstieg im Feld Denkmalpflege, Tourismus, Welterbe erhielten. So erfuhren wir, dass man in unserer Stadt, ebenso wie in Berlin und Stuttgart, Denkmalpflege studieren kann, wobei unsere Führerin die Meinung vertrat, dass man dieses Fach am besten in Bamberg studieren sollte, weil es hier vor Ort sehr viele praxisbezogene Übungs- und Forschungsobjekte gibt. Außerdem werden im „Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologie“, das sich Am Zwinger 4 befindet, folgende Fachbereiche angeboten:
- Bauforschung, Baugeschichte, Bauerhalt
- Fachbereich Restaurierungswissenschaften
- Digitale Denkmaltechnologien
Nach dem Studium könnte man eventuell sogar ganz in der Nähe der Universität einen Arbeitsplatz finden, zum Beispiel in der Außenstelle des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege in Schloss Seehof in Memmelsdorf oder eben im Welterbezentrum. Dabei geht es hier um alles andere als verstaubte Kulturgüter, wie vielleicht manch einer denken mag. Das neue Schlagwort heißt „Smart City“, ein Projekt, bei dem mit Finanzmitteln aus einem Bundesförderprogramm ein Monitoring durchgeführt wird und mit digitaler Denkmaltechnologie ein „digitaler Welterbezwilling“, also eine 3D-Kopie unserer Stadt, erschaffen wird. Dieser „digitale Welterbezwilling“ soll Leuten mit Behinderung den Besuch von Welterbestätten ermöglichen und zudem wird so der „Erhalt“ von Welterbestätten in digitaler Form für die Nachwelt gewährleistet, falls diese durch Naturkatastrophen oder, wie zum Beispiel zur Zeit in der Ukraine, durch Kriege zerstört werden. Solch eine digitale Stadt soll in Bamberg in Zukunft auch dabei helfen, Besucherströme besser zu lenken, damit sich nicht zu viele Touristen gleichzeitig an bestimmten Sehenswürdigkeiten konzentrieren.
Neben dem Projekt „Smart City“ ist der Bereich „Urban Gardening“, zum Teil in Zusammenarbeit mit der Transition-Bewegung, momentan ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld des Welterbezentrums Bamberg. Dieses muss zudem jedes Jahr einen Bericht für die Unesco verfassen und über neue Entwicklungen in der Stadt, zum Beispiel über den Ausbau der ICE-Strecke am Rand der geschützten Gärtnerstadt, berichten, damit wir unseren Welterbetitel nicht verlieren. Diesbezüglich besteht jedoch keine Gefahr für Bamberg und selbst eine Errichtung von Schallschutzwänden entlang der Bahnstrecke wäre erlaubt.
Anders verhielt es sich 2009 in Dresden, wo nach dem Bau der Waldschlösschenbrücke der Welterbetitel für das Dresdner Elbtal wieder entzogen wurde. Auch Liverpool verlor 2021 seinen einst für das historische Zentrum und das Hafengebiet verliehenen Welterbetitel, nachdem die Stadt nicht auf substanzielle moderne bauliche Eingriffe im historischen Hafengebiet, wie den Bau eines Fußballstadions, verzichten wollte. Ein Welterbetitel wurde bisher insgesamt nur dreimal wieder aberkannt. Der Präzedenzfall ereignete sich im Jahr 2007 im Oman, wo einem Wüstenschutzgebiet für seltene Oryx-Antilopen der Welterbe-Status für dieses Areal entzogen wurde, weil der Oman dort Erdöl fördern wollte und dies später auch tat.
Ehe solch eine drastische Maßnahme ergriffen wird, kommt ein Welterbeobjekt jedoch erst auf die Rote Liste der Unesco, was zum Beispiel derzeit bei der Stadt Wien wegen eines umstrittenen Hochhausprojekts in der Innenstadt der Fall ist. Es gibt jedoch stets neue Anwärter für den Welterbetitel. So möchte München im Moment für den Olympiapark einen Platz auf der Welterbeliste ergattern. Dieser Prozess wird sich aber über mindestens fünf Jahre hinziehen, da zunächst eine etwa 1.000-seitige wissenschaftliche Abhandlung geschrieben werden muss. Bamberg erhielt 1993 seinen Welterbetitel, bereits zwei Jahre nach der Bewerbung. Man nominierte Bamberg vor allem wegen seiner mittelalterlichen Stadt mit barocker Überprägung, wegen der die Unesco Bamberg eine Vorbildfunktion für andere Städte zuschrieb. Unsere Stadt wurde somit Teil der „Welterbefamilie“, die inzwischen 1.154 Stätten zählt, von denen 51 in Deutschland sind. Leider ist dies nur ein ideeller Wert, denn die Unesco ist „chronisch pleite“ und beteiligt sich nicht an der Finanzierung zum Erhalt ihrer Welterbestätten. Nachdem die USA unter Trump die Unesco verlassen haben, fehlt zudem ein weiterer Geldgeber.
Welterbe umfasst aber auch das sogenannte „Immaterielles Kulturerbe der Menschheit“, und auch hier wird wieder deutlich, dass dies alles andere als verstaubte Objekte sind, denn, wer hätte es gedacht, hierzu zählen die Pizza aus Neapel, der urbane Gartenbau und seit 2021 auch der moderne Tanz in Deutschland sowie die Flößerei.
Welterbe hat, zumindest für Außenstehende, sogar einige humorvolle Aspekte. So rufen beispielsweise manchmal Privatpersonen im Welterbezentrum an, um ihre Nachbarn zu verpetzen, indem sie berichten, dass manch ein Gärten sein Grundstück gar nicht mehr landwirtschaftlich nutzt, und die Anrufer drohen sogar damit, dass sie sich an die Unesco wenden, damit Bamberg seinen Welterbetitel verliert. Ab und zu muss das Welterbezentrum jedoch auch Unstimmigkeiten unter den Bamberger Gärtnern beseitigen. Die Gärtner sind für den Erhalt des Welterbetitels wichtig, allerdings haben sie durch die Unesco-Auflagen, oftmals – gerade im Vergleich zu Nicht-Unesco-Gärtnern – viel schwierigere Arbeitsbedingungen und somit gravierende Wettbewerbsnachteile. Hier ist Frau Patricia Alberth wieder eine wichtige Schnittstelle zwischen der Unesco und der Bamberger Stadtverwaltung.
Am Ende erfahren wir, dass man sich auch ehrenamtlich für Bambergs Denkmäler einsetzten kann, wie beispielsweise in der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V., einer gemeinnützigen Vereinigung zum Schutz Bamberger Kulturdenkmale. Beim Hinausgehen, vorbei an der Sonderausstellung zum Unesco-Welterbe in der Ukraine, lohnt sich noch ein Blick auf die Außenfassade des Besucherzentrums, denn selbiges besteht in dem Gebäudeteil, der sich vor dem modernen Neubau befindet, noch aus Überresten der alten Sterzermühle. Die alte Bamberger Mühlentradition wird heute sogar noch fortgesetzt, denn unter dem Welterbezentrum befindet sich eine moderne Turbine, mit der aus Wasserkraft Energie gewonnen wird.
P-Seminar Merz