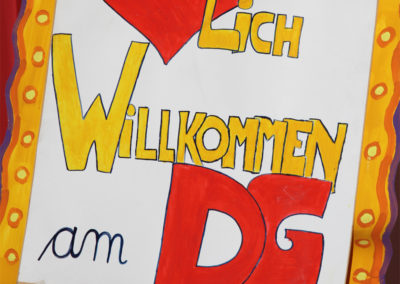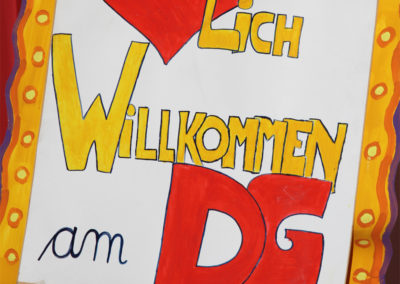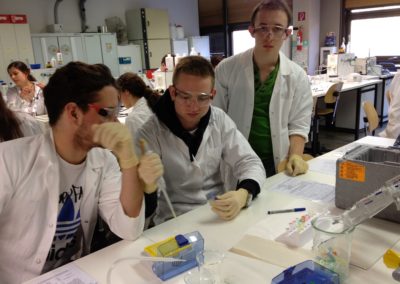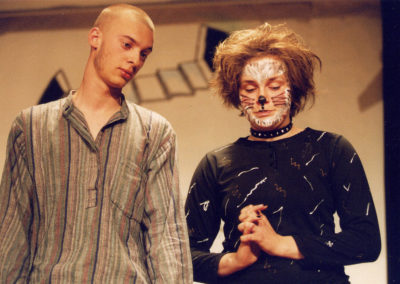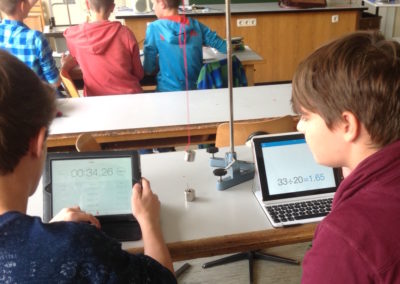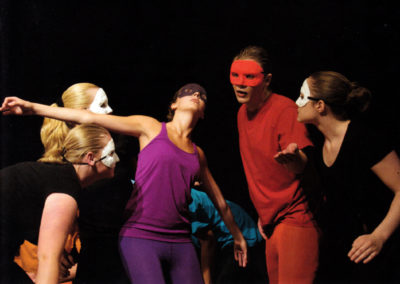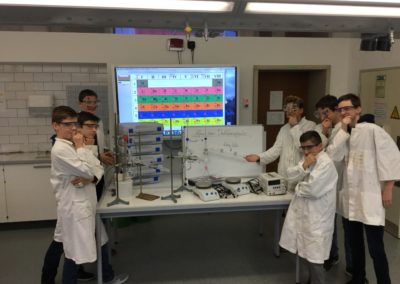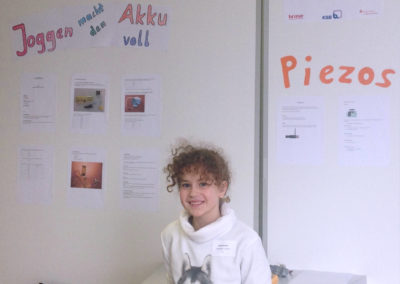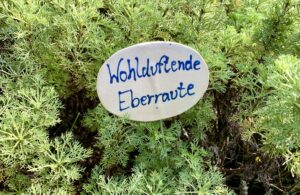Alpenüberquerung – ein Begriff bei dem es vielen Wanderen sofort in den Beinen kribbelt, aber bei etlichen davon steht er noch auf der persönlichen to-do-Liste. Die Teilnehmer am diesjährigen P-Seminar “Alpencross” erleben in den kommenden sieben Tagen den Mythos “Alpenüberquerung”. Ihre Erlebnisse verfassen sie in diesem Blog.
Tag 7: Etappe 6
Der 7. Tag begann um 7:00 mit einem ausgiebigen Frühstück. Nachdem wir unsere Rucksäcke gepackt hatten, ging es auch schon wieder los- 7:45 Uhr Abmarsch, für ein paar wenige unter den Schülerinnen, wie immer, zu früh. Die heutige Etappe war die letzte und führte uns während eines über vierstündigen Aufstiegs auf mehr als 3000 Meter. Unterwegs trafen wir sie wieder – unsere vier Freunde aus Vechta (Nico, Jan, Jens und Daniel). Diese hatten wir am ersten Tag, bei der ersten Rast an der Kapelle, kennengelernt. Unseren Tipp mit der Gumpe hatten sie auch umgesetzt und waren uns für diese Insiderinformation richtig dankbar. Unterwegs kreuzten sich unsere Wege immer wieder einmal. Auch dies gehört zum Mythos „Alpenüberquerung“, man lernt Personen kennen, auf welche man unterwegs des Öfteren trifft. Dazu gehörte auch eine Gruppe von Achtklässlern aus Kassel, die zumindest Teile unseres Weges absolviert haben. Die Lehrkräfte dieser Gruppe kennen wir als Lehrerteam bereits aus den vergangenen Jahren. Wir treffen uns einmal im Jahr am Dienstag auf der zweiten Etappe und später auf der Ansbacher Hütte.
Nicht weit von unserem höchsten Tagespunkt entfernt wurde der „Ötzi“ gefunden. Passend dazu ging es heute noch einmal über ein kleines Schneefeld. Auf der Similaun Hütte stärkten wir uns dann für den kommenden Abstieg. Dieser dauerte 2,5 Stunden und brachte uns in das Tal. Das Ziel, der Vernagter Stausee, war bereits von der Hütte aus zu sehen und zog uns fast magisch an. Die Höhenmeter im Abstieg verflogen und es wurde immer wärmer. Somit erreichten wir sowohl 1250 Höhenmeter bergauf als auch bergab. Im Tal angekommen, bekamen die SuS zum Abschluss unserer Alpenüberquerung jeweils ein Getränk spendiert, welches wir zusammen mit unseren Vier aus Vechta tranken. Die Unterkunft in Meran besaß sogar einen kleinen Pool, auf welchen sich alle den ganzen Tag über gefreut hatten. Besonders angesichts der hohen Temperaturen von über 35 Grad, war der Sprung in das kühle Nass ein weiterer Höhepunkt unserer Tour 2023. Die Pizza am Abend rundete unseren letzten Wandertag gut ab. Am Morgen brachen wir bereits um 5:30 Uhr wieder auf, um uns auf den Rückweg nach Bamberg zu machen. Zwischen uns und Bamberg stand nur noch die Deutsche Bahn mit ihren vielen Ausfällen und Verspätungen. Mit nur einer Stunde Verspätung erreichten wir Bamberg.
Eine richtig tolle Truppe von Schülerinnen und Schülern aus der 11. Jahrgangsstufe des Dientzenhofer-Gymnasiums hatte es im Rahmen des P-Seminars „Alpencross“ geschafft – die Alpenüberquerung – ein Mythos wurde erlebt. Damit war das DG bereits dreimal über die Alpen gegangen. Kommendes Jahr folgt Nummer vier.
Platzöder, Reinauer
Tag 6: Etappe 5
Nach einer wirklich kalten Nacht in dem Schlaflager, welches unglücklicherweise im Keller lag, standen alle SchülerInnen um 5:15 Uhr auf. Der Zeitplan war heute nämlich ziemlich streng, da wir nach dem Frühstück die schwerste Etappe mit Schneefeldern über den Gipfel schaffen wollten bevor alle anderen Gruppen losgehen. Um 7 brachen wir auf, balancierten uns über die Steine und überholten noch 2 andere Gruppen. Es war erst sehr kalt, doch oben angekommen schien die Sonne, welche uns den ganzen Tag erhalten blieb. Ein Teil unserer Gruppe kletterte noch ein paar Meter weiter, um die 3000 m zu erreichen. Hinunter mussten wir erst ein Stück am Seil entlang klettern und danach konnten wir durch eine Schneerutsche hinunter sausen (siehe Video).
Nachdem der Weg zur Talstation des Skigebiets Sölden am dort liegenden Gletscher geschafft war, fuhren wir mit dem Bus durch den Rosi-Mittrrmeier-Tunnel. Dort nahmen wir den Panoramaweg nach Vent. Den langen Weg schafften alle mit genug Pausen und grandiosem Ausblick problemlos. Nach weiteren 4 Stunden kamen wir endlich in Vent an. Im Hotel haben alle den Luxus genossen, so lange wie sie wollen duschen zu können, ohne dafür zu bezahlen. Auf uns wartet nun ein Abendessen mit 3 Gängen.
Leni und Emilia
Tag 5: Etappe 4 – Gletscherbriese
Unsere Schülerinnen und Schüler haben die technisch anspruchsvollen 1010 hm bei regnerischen Wetter ohne Probleme gemeistert. Es war kein Murren zuhören, aber sehr oft “wow”.
Nach dem Verlassen unserer mongolischen Jurte am Morgen, begann der nebelige Tag mit einem ausgiebigen Frühstück, welches selbstgebackenes Brot so wie Marmelade und herzhaftes umfasste. Anschließend begann der steile Abstieg im rutschigen und nebeligen Wald, welcher von einer Moralpredigt Herr Reinauers abgeschlossen wurde. Der kurze Weg führte uns daraufhin zu dem vorher gebuchten Kleinbus, welcher uns mit einem Boxenstop bei einem Supermarkt zum nächsten Anstieg in Mittelberg kutschierte. Der Aufstieg begann in Richtung eines gigantischen Gletscherwasserfalls, welcher uns den ganzen Weg bis nach oben zum Gletscher begleitete. Die Wanderwege variierten von Schotterstraßen bis zu Kletterpassagen, welche man auf allen Vieren bestreiten musste. Die Konzentrationsfähigkeit war heute gut gefordert und das essenziellste Attribut. Das wunderschöne Panorama überdeckte den Starkregen, der die Gruppe ab der Hälfte des Weges zunächst schwächte. Die immer stärker werdende Gruppendynamik brachte jeden aus der Gruppe, trotz Handicaps nach oben zum Ziel. Angekommen bei der Hütte gönnten sich einige Schüler, nach einer heißen Dusche, einen vorzüglichen Kaiserschmarren. Nach ein paar Momenten Ruhe, entschieden sich einige verrückte Schüler, sowie Marcelo und Valerie ein angenehmes Bad im eiskalten Gletschersee, welcher vor der Hütte lag, zu nehmen. Nach einem interessanten Abendessen begaben sich die Schüler recht früh ins Bett, um sich für das Ausfstehen um 5:15 vorzubereiten.
Tag 4: Etappe 3
Der Dienstag endete auf der Ansbacher Alm in 2387 m mit heftigen Gewittern, die den Eindruck erweckten, die Welt gehe unter. Dementsprechend endete eine wieder eher kurze Nacht zu 17 in einem Zimmer und wir brachen um 7:15 mit langen Klamotten bei kühlem Wetter zu unserer Tour zur Larcher Alm auf.
Noch ein Bild und plötzlich begann es zu regnen; Regenjacken an, Regenschutz auf den Rucksack und los ging es.
Der Abstieg erwies sich allerdings als nicht ganz so leicht aufgrund des heftigen Regens, Hagels und des starken Windes in der hohen, ausgesetzten Lage (siehe Video).
Des Weiteren musste eine Schülerin eine “lebensgefährliche” Rettungsaktion ihres Regenschutzes meistern und slidete bis kurz vor den tiefen Abgrund des Elektrozauns.
Auf dem Weg haben wir dann übrigens noch erfahren, dass unsere Jurte, das Schlaflager für die nächste Nacht, aufgrund des Sturm weggeflogen war.
Durchnässt kamen wir rechtzeitig in Schlann an, nachdem alle SchülerInnen den Abstieg unbeschadet gemeistert hatten.
Die ca. 20 minütigen Busfahrt nach Landeck war allen Beteiligten mehr als Recht und wurde von vielen für einen kleinen Nap genutzt.
Dort angekommen stärkten wir uns erstmal im örtlichen Mc Donalds und dann ging es um 12 Uhr mit der Seilbahn bei strahlendem Sonnenschein und mit inzwischen wieder getrockneten Klamotten auf dem Berg.
Dort angekommen wählten wir aufgrund der unsicheren Wetterlage und dem vorher gesagten Gewitter um 15 Uhr anstelle des Gipfelwegs entlang des Gebirgskamms zur Larcher Alm den Weg mit wenigeren Höhenmetern im Windschatten des Bergs.
Dies erwies sich als gute Entscheidung, da wir auf dem ca. 3 Stunden langen Weg mehrfach von Regenschauern überrascht wurden.
Auf der Larcher Alm angekommen wurde erstmal bei den Schlaflagern improvisiert, die Jungen halfen dabei ihr “neues” Zelt auszustatten und die Mädchen bekamen ihre Betten im Haus zugewiesen.
Zum Schluss hat das Abendessen von Wirt Gregor mit Vorspeisensuppe, Linseneintopf und sehr leckeren Nachtisch den Tag gut abgerundet.
Lisa und Lara
Tag 3: Etappe 2
Der Tag startete nach einer erholsamen Nacht mit verspätetem Abmarsch, da einer der Schüler über ein schlechtes Zeitmanagement bzw. Zeitgefühl verfügt. Als Konsequenz wurde dieser als Redakteur für den Bericht des heutigen Tages ernannt.
Das Frühstück kauften sich die Schüler im nahegelegenen Supermarkt. Währenddessen kam einer dieser Gymnasiasten auf die brillante Idee sich zwei Blöcke Käse zu besorgen, bei denen es sich um extrem pikant riechende Bergkäse alias “Stinkekäse” handelte.
Im Gegensatz zu vielen anderen Wanderern hatten wir den einzigen Kleinbus, der in das anstrebte Tal fahren darf, vorgebucht. Allerdings kam es trotzdem zu einer Verzögerung, da die Fahrt vor uns zu spät gestartet war. Wenigstens blieb uns dabei mehr Zeit zum frühstücken.
Im hoffnungslos überfüllten Taxibus verbreitete sich bei einigen schnell Angst, da der Fahrer mit gefühlten 80 km/h über kurvige Schotterwege im Wald schürte. Nach dem dritten Stoßgebet kamen wir so gut wie unversehrt an dem Startpunkt der heutigen Wanderung an.
Nun begannen wir unseren fünfstündigen Aufstieg zur Flarsch Joch Scharte.
Anfangs folgten die motivierten Schüler einem Talweg der mehrfach von kleinen Bachläufen gekreuzt wurde, an denen wir unsere Trinkvorräte auffüllen konnten. Die Idylle und Harmonie der Landschaft wurde lediglich durch den immer noch währenden Gestank des Käses gestört.
Nach dem die ersten Schüler schwächelten übernahmen sieben physisch stärkere deren Rucksäcke für einige Meter.
#Teamwork
Zum Schluss endete die kräftezehrende Tour auf der Ansbacher Hütte.
(Matteo hat die Ü18 Mitwanderer zum Schere heben 🖖 überredet und kann nun in Frieden schlafen gehen)
Verfasser Jakob Stollberger und Bastian Ramer
Tag 2: Motto des Tages: „Macht euch kein Stress!“
7.30 Uhr Frühstück, alle Schüler haben sich glücklich und geschlossen zum Essen begeben . Nachdem das Motto „Macht euch kein Stress“ für den heutigen Tag angesetzt worden war, gab es bereits früh eine kleine Einschränkung. Herr Platzöder übermittelte uns die Nachricht, dass der Bus schon da sei (7.45 Uhr wie geplant). Nach einer 20-minütigen Busfahrt ging es endlich los. Die erste Viertelstunde war es ein geteerter Weg, dann kamen die ersten Hindernisse( Wurzeln, Steine, Gestrüpp), die von den Schülern mit Bravour gemeistert wurden. Lediglich für einen Hüttenschlafsack war diese Aufgabe zu groß, er stürzte in eine tiefe Schlucht und wurde seitdem nie wieder gesehen. Nach 3 Stunden Wandern bei perfektem Wanderwetter sahen wir die Kemptner Hütte, wo wir uns mit einem grandiosen Mittagessen für die anstehenden Stunden stärkten. Nach Auffüllen der Trinkflaschen führte uns der Weg zur deutsch- österreichischen Grenze. Von da an stiegen die Schüler stetig bergab und erreichten eine Gumpe, in der sich die Schüler und Lehrer ein eiskaltes Bad gönnten. Das nächste Highlight war eine der längsten Hängebrücken Österreichs, bevor wir Holzgau erreichten. Mit einem geliehen Einkaufswagen ging es zu unserer Herberge, wo wir gemeinsam das wohlverdiente Abendessen kochten und genossen.
Fazit: Rucksäcke immer geschlossen halten, Kochen ist keine schwere Sache und Abspülen durch Matse, Luis, Lars und Michel war ein Meisterwerk
Nils, Annika und Matteo
Tag 1: Anreise
Sonntag 12:10 Treffen am Bahnhof Bamberg. Während die Lehrkräfte leicht verspätet eintrafen, kamen die Schüler Matteo und Michel (Verfasser dieses Beitrags) auf die glorreiche Idee, sich 10 min vor Abfahrt (12:38), noch etwas beim Megges abzuholen. Aber ohne Probleme schafften es beide in den Zug, einer mit Megges Menü einer ohne – aber bezahlt. Und nun ging es entspannterer Weise los – zumindest bis zur nächsten Haltestelle in Nürnberg. Von dort aus ging es einwandfrei nach Treuchtlingen, wo es krachte, denn der nächste Zug nach Augsburg war so überfüllt, dass die fantastischen Schüler von Platzi und Reini nicht mehr zusteigen konnten. Eine Stunde später sollte es nach Augsburg weitergehen. Der nächste Zug der DB hatte allerdings Probleme und so blieben wir in Donauwörth stecken. Nach ein paar weiteren Irrungen und Wirrungen waren wir schlussendlich alle wieder in Augsburg vereint und nahmen zusammen den nächsten Zug, welcher nur 20 min Verspätung hatte. Von Augsburg ging es nach Kempten ohne weitere Probleme und von dort aus weiter nach Oberstdorf, wo wir uns mit dem Bus Richtung Jugendherberge bewegten. In der Jugendherberge wartete auf uns Rindergulasch mit Spätzle und Blaukraut – bereit gestellt von den Zukömmlingen Valerie und Marcelo ( Kuss an die Beiden )
Matteo und Michel