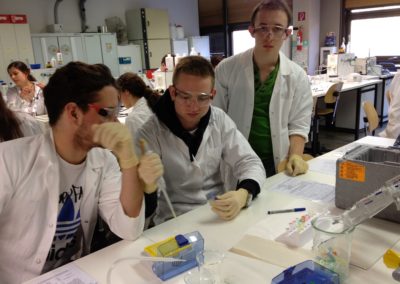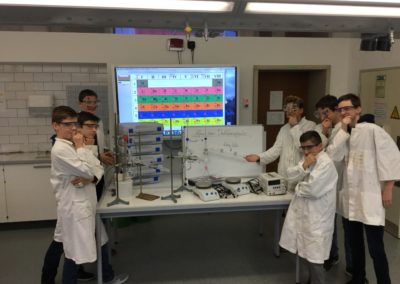Gefundene Kinder, exotische Früchte, Stockhiebe von Lehrern und ganz viel Geduld
Wir sind in Uganda. Als Frau Janina Möck vor den Geographiekursen der Q12 einen packenden Vortrag zum Thema Entwicklungshilfe hielt, waren wir fast live in Afrika mit dabei, obwohl wir eigentlich im – wegen des Corona-Hygienekonzepts – gut gelüfteten und somit kühlen Mehrzweckraum des DG saßen. Die sonst so relativ trockenen Theorien zur Entwicklungshilfe waren plötzlich aufgrund der interessanten Berichte von Frau Möck über das von ihr initiierte Hilfsprojekt auf einmal gar nicht mehr bloße graue Theorie, sondern schillernde Geschichten über Land und Leute in dem Entwicklungsland Uganda.
Frau Möck hat nämlich nach ihrem Abitur im Jahr 2013 bei einer großen Organisation ein freiwilliges soziales Jahr in Afrika absolviert. Dabei stellte sie fest, dass dabei viele Aktivitäten weder hilfreich noch zielführend waren, woraufhin sie kurzerhand ein eigenes Entwicklungshilfeprojekt namens „We care for them“ in Uganda gründete. Ehe sie aber darüber berichtete, wie sie ihr Hilfsprojekt aufgezogen hat, erfuhren die SchülerInnen einige Kuriositäten vom afrikanischen Kontinent.

- So gibt es in Uganda 60 verschiedene Sprachen. Leute, die etwas weiter voneinander entfernt wohnen, haben oft keine Chance, sich gegenseitig zu verständigen. Die offizielle Sprache ist zwar Englisch, aber dies können nur die Leute, die eine gute Schule besucht haben, also nur sehr wenige.
- In Uganda gibt es auch noch die typische „Bevölkerungspyramide“ mit vielen Kindern und nur wenigen alten Menschen – im Gegensatz zur „Urnenform“ bei der Bevölkerungsdarstellung, die für Deutschland typisch ist. Etwa 50 Prozent der Einwohner von Uganda sind unter 18 Jahre alt. Gebildete Leute haben nur zwei bis drei Kinder, aber in Dörfern sind 10 bis 16 Kinder pro Familie keine Seltenheit. Daher besteht ein Ziel der von Frau Möck im Jahr 2014 gegründeten Organisation darin, ein besseres Schulsystem aufzubauen als es dem Standard in Uganda entspricht, um auf diese Weise auch etwas gegen das rapide Bevölkerungswachstum zu unternehmen.

- Frau Möck hat die zahlreichen Kinder, denen sie mit ihrer Organisation hilft, im wahrsten Sinne des Wortes „gefunden“, zum Teil auf der Straße oder auf Baustellen. So hat „We care for them“ beispielsweise einen Fischweiher angelegt, wobei dabei ein sehr junger Tagelöhner auffiel. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass er erst 11 Jahre alt war und nicht mehr in die Schule ging, weil seine Mutter das nötige Schulgeld nicht aufbringen konnte. Die Geschichte dieses Jungen namens Brian ist typisch für viele Kinder in Uganda. Brians Vater hat seine Mutter und seinen älteren Bruder verlassen, als die Mutter schwanger war. Danach hat Brians Mutter einen neuen Mann kennengelernt, von dem sie weitere Kinder bekam, denn die Tatsache, dass ein Paar „fest zusammen ist“, manifestiert sich in Uganda nicht durch einen offiziellen Trauschein, sondern dadurch, dass man gemeinsame Kinder hat. Brians Vater kümmerte sich anschließend, nur noch um seinen eigenen Nachwuchs und nicht um die Kinder aus früheren Beziehungen der Frau. Brian und sein Bruder kamen später zu ihrer Oma und sobald genug Geld da gewesen wäre, sollten sie wieder in die Schule gehen dürfen. Da dies aber nie der Fall war, musste Brian schon seit mehreren Jahren als Tagelöhner arbeiten. Für Brian erwies es sich daher als eine Art „Lottogewinn“, dass er Frau Möck bei der Anlage des Fischweihers für „We care for them“ aufgefallen ist, denn sie nahm ihn daraufhin in ihrem Kinderheim auf. Ein Tropfen auf dem heißen Stein – für Brian aber mehr als nur eine glückliche Fügung.

- Schockierend ist auch die Tatsache, dass Polygamie in der Kultur Ugandas noch tief verwurzelt ist. Manche Männer haben drei bis sieben Frauen und häufig ist nicht bekannt, wie viele Kinder ein Mann tatsächlich hat. Dies gilt bis zu dem Zeitpunkt seiner Beerdigung, denn da kommen alle Blutsverwandten zusammen und so manche Geschwister lernen sich bei diesem Ereignis zum ersten Mal kennen.

- Eine weitere Geschichte, die die SchülerInnen aufhorchen ließ, waren Frau Möcks Ausführungen über die sogenannten Regelschulen. Eine Klasse besteht dort aus circa 50 Schülern und die Lehrer sorgen mit Stockhieben für Ruhe und Disziplin. Mathematik läuft wie eine militärische Drillübung ab und es geht eigentlich nur um ein stupides Auswendiglernen. Lehrer: „Fünf plus drei?“ – Schüler: „Fünf plus drei ist acht.“ Die Tatsache, dass die nötigen logischen Verknüpfungen häufig fehlen, erkennt man daran, dass, wenn die Schüler anschließend gefragt werden, was das Ergebnis von acht minus fünf sei, völlige Ratlosigkeit bei den Schülern herrscht. Dieses Problem wird auch sichtbar, wenn ältere Leute in einem Geschäft kleine Kügelchen auf ein Blatt Papier malen, um zum Beispiel acht minus fünf „auszurechnen“.
- In Frau Möcks Vortrag gab es auch noch ein paar Praxisbeispiele aus dem geographischen Themenblock „Klima in den Tropen“. So erklärte sie, dass man in Uganda, das fast genau auf dem Äquator liegt, zweimal pro Jahr ernten kann, weil die ITC, die Innertropische Konvergenzzone, zweimal im Jahr über das Land zieht und es daher dort zu zwei Regenzeiten kommt. Es gibt weder Frühling, Herbst oder Winter. Vor der Regenzeit wird gesät, dann regnet es zwei Monate lang auf die Felder und anschließend erntet man. Wenn man dann noch, so wie Frau Möcks Organisation, einen eigenen Brunnen gebaut hat, kann man auch in der Trockenzeit auf den Feldern etwas anbauen. In den Jahren, in denen man nicht alle landwirtschaftlichen Erträge für das Kinderheim von Frau Möck benötigt, werden die Überschüsse verkauft. Diese erzielen dann auf dem Markt besonders hohe Preise, weil man ja während der Trockenzeit einer der wenigen Anbieter auf dem Markt ist. So unternahmen die Geographen der Q12 auch gleich noch einen kurzen Exkurs in das Fach Wirtschaft. Als die SchülerInnen hörten, welche Früchte auf den Feldern in Uganda angebaut werden, wären einige von ihnen an dem grauen Mittwochnachmittag am liebsten gleich direkt nach Afrika geflogen, denn dort gibt es: Bananen, Maracujas, Papayas, Mangos, Avocados, Wassermelonen, Zuckerrohr, Erdnüsse, Manioks, Süßkartoffeln, Reis und vieles mehr.

- Frau Möcks Ehemann Isaac berichtete dann auf Englisch, dass in Uganda viele Kinder auf den Feldern arbeiten müssen, weil sie durch den Verkauf der landwirtschaftlichen Erzeugnisse das nötige Schulgeld für ihren eigenen Schulbesuch verdienen müssen.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist eine mittlerweile recht abgedroschene, wenngleich sehr richtige Forderung, wenn es um Entwicklungshilfeprojekte geht. Frau Möck veranschaulichte jedoch der Q12, wie man diesen schnöden Satz in die Tat umsetzen kann.
- Bei Entwicklungshilfeprojekten ist es wichtig, dass man sich die kulturellen Unterschiede zwischen dem helfenden und dem zu helfenden Land bewusst macht. So ist in Uganda das Wissen der Ahnen, die Tradition und der Rückbezug auf die eigenen Wurzeln oftmals bei Entscheidungen wichtiger als ein rein rationales Denken. Aus diesem Grund muss man bei Projekten immer sehr langsam vorgehen, weil man sonst „die Leute „verliert“.
- Man braucht für ein Entwicklungshilfeprojekt stets eine ausreichende Anzahl von einheimischen Mitarbeitern, denn sonst bricht jedes Projekt in sich zusammen, sobald die ausländischen Initiatoren wieder in ihre Heimat zurückkehren.
- Der Aufbau einer eigenen Landwirtschaft ist essenziell. So hat „We care for them” anfangs mehrere Grundstücke gekauft, um darauf Nahrung anzubauen, ehe die ersten Kinder im eigenen Waisenhaus aufgenommen wurden. Mithilfe dieser eigenen Landwirtschaft können diese Kinder nun fast komplett eigenständig, und somit ohne weitere finanzielle Ausgaben, ernährt werden und die landwirtschaftlichen Überschüsse werden zudem gewinnbringend verkauft.

- Geduld, Vertrauen und Kontrolle sind ein „Dreiklang“, der zum Erfolg führt. Wenn Entwicklungshelfer mit viel Hektik, Druck und unrealistischen Deadlines ein Projekt in Angriff nehmen, wird es hundertprozentig scheitern. Warum? Viele Afrikaner haben eine Art „Schamkultur“, das heißt, wenn sie bei Projekten allzu strenge Zeitlimits nicht einhalten können, dann tun sie eher so, als wäre alles erledigt und in Ordnung anstatt zuzugeben, dass sie eine bestimmte Aufgabe nicht bewältigen konnten. Somit ist die Schaffung eines grundlegenden Vertrauensverhältnisses zwischen den Helfern und den zu Helfenden wichtig für den Erfolg eines jeden Projekts.
- Wenn man die zuvor angeführten Schritte erfolgreich absolviert hat, ist es schließlich möglich und auch wichtig, das Projekt als interkulturelle Zusammenarbeit, die auf einem gegenseitigen Lernen von den Stärken des anderen basiert, weiterzuführen. Frau Möck hat dabei erfahren, dass die Afrikaner von ihrem westlichen, strategischen, erfolgsorientierten Denken profitieren, während die Europäer in ihrer hektischen Alltagswelt wieder das Gefühl der Lebensfreude sowie die Zufriedenheit mit kleinen Dingen von den Afrikanern neu erlernen können.
- Am Ende eines jeden Entwicklungshilfeprojekts muss es mögliche sein, Verantwortung abzugeben. So betont Frau Möck, dass sie bei „We care for them“ nun nur noch eine begleitende Funktion hat und dass ihr Projekt ansonsten gut und selbstständig läuft.

Somit waren wir für etwa eine Stunde fast live in Uganda mit dabei. Naja, nicht ganz, oder eventuell noch nicht ganz? Es ist nämlich möglich, ein Praktikum bei „We care for them“ zu absolvieren. Dies haben bereits zahlreiche SchülerInnen nach dem Abitur getan. Wer weiß, vielleicht ist in Zukunft auch ein DGler dabei?
G. Merz

https://wecareforthem.eu/de/home
IBAN: DE 7276 39 1000 0007 7528 49; BIC: GENODEF1FOH; Volksbank Forchheim eG